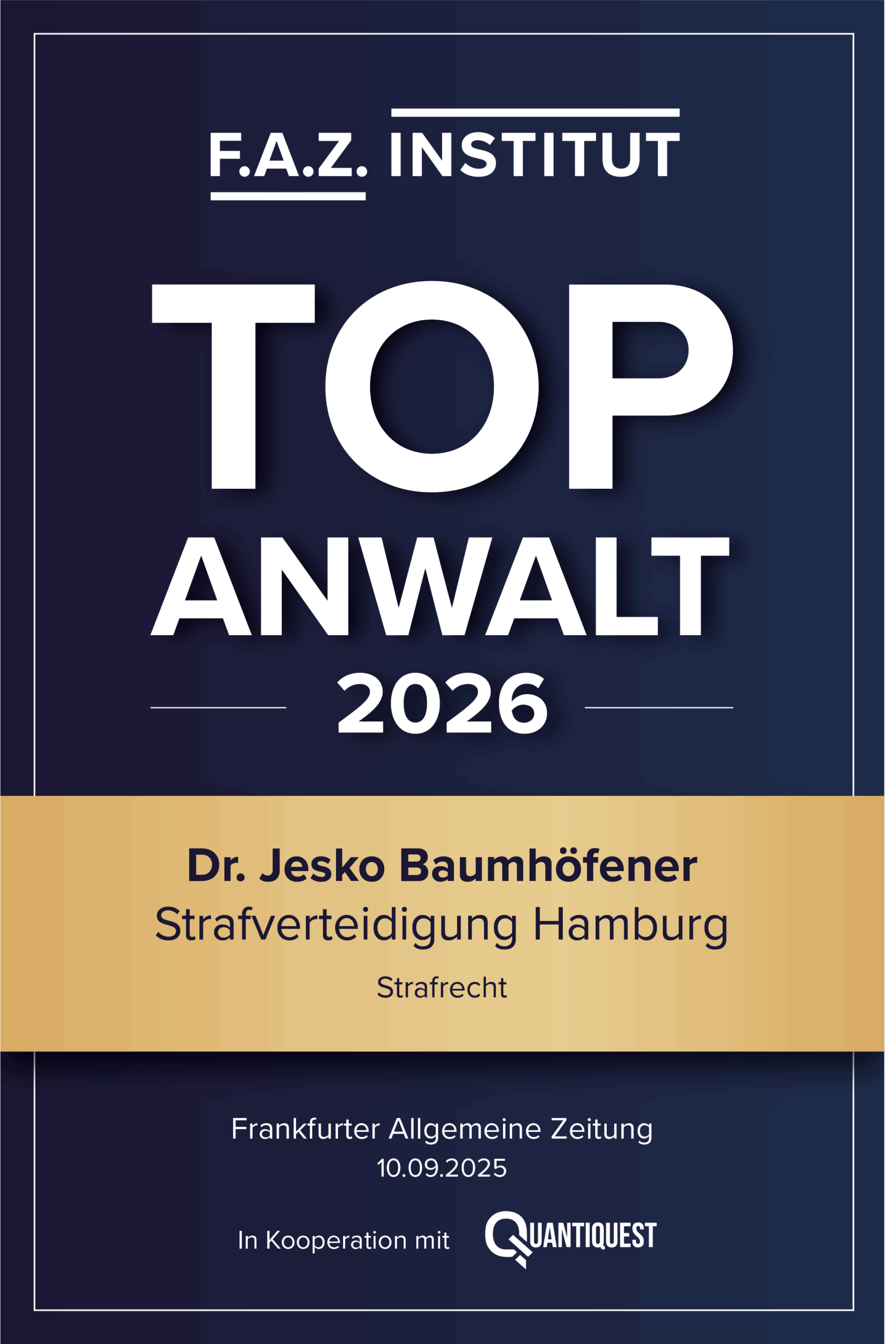Erhält ein Beschuldigter eine Anklageschrift oder einen Strafbefehl, sind die polizeilichen Ermittlungen bereits abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, das Strafverfahren zu eröffnen. In diesem Moment ist es entscheidend, sofort einen erfahrenen Strafverteidiger zu kontaktieren, um das Verfahren in eine möglichst günstige Richtung zu lenken.

In diesem Artikel erfahren Sie, was eine formelle Mitteilung genau enthält, welche Strafvorschriften relevant sind, wie die Staatsanwaltschaft und die Gerichte vorgehen und welche Möglichkeiten bestehen, sich gegen die Vorwürfe zu wehren. Wir erläutern zudem, wann das Amtsgericht, das Landgericht oder in besonderen Fällen das Oberlandesgericht zuständig ist, welche Beweisstücke typischerweise in der Anklageschrift genannt werden und wie Sie in Zusammenarbeit mit einem Verteidiger Ihre Verteidigung optimal vorbereiten können.
Was ist eine Anklageschrift?
Die formelle Mitteilung der Staatsanwaltschaft zeigt an, dass ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und ein Strafverfahren eröffnet wird. Sie markiert den offiziellen Startpunkt für das Hauptverfahren und dient sowohl dem Gericht als auch dem Angeschuldigten als verbindliche Grundlage für das weitere Vorgehen.
Mit der Erhebung der Anklage wird der Beschuldigte offiziell als Angeschuldigter bezeichnet (§ 157 StPO). Ab diesem Zeitpunkt beginnt die gerichtliche Verfolgung der Straftat formal – auch wenn dies noch nicht gleichbedeutend mit einer Verurteilung ist. Für den Beschuldigten ist dies jedoch ein entscheidender Moment, da nun Rechte wie das Schweigerecht, das Recht auf Akteneinsicht und die Möglichkeit zur Stellungnahme geltend gemacht werden können.
Die Mitteilung enthält in der Regel detaillierte Angaben zum Tatzeitpunkt, Ort der Begehung, zur Art der Straftat sowie die konkrete Benennung der Strafvorschriften, die verletzt sein sollen. Zudem wird angegeben, welche Beweisstücke – wie Zeugenaussagen, Urkunden oder Gutachten – im Verfahren eine Rolle spielen. Der Inhalt der Anklageschrift ermöglicht somit eine präzise Vorbereitung auf das Strafverfahren.
Darüber hinaus kann die Mitteilung Aufschluss darüber geben, ob die Staatsanwaltschaft alternativ einen Strafbefehl beantragen könnte, insbesondere bei weniger schweren Straftaten. In der Praxis prüfen Strafverteidiger auch, ob formale Fehler oder Unklarheiten in der Mitteilung bestehen, die die Verteidigung unterstützen können.
Praxis-Tipp: Eine frühzeitige Einbindung eines erfahrenen Strafverteidigers ist entscheidend, um die Rechte des Angeschuldigten zu wahren, die Ermittlungsergebnisse einzusehen und eine strategische Planung für das Hauptverfahren vorzunehmen. Dabei können auch Details wie die exakte Anschrift, persönliche Daten des Beschuldigten und die Konkretisierung der Tatvorwürfe genutzt werden, um eine fundierte Verteidigungsstrategie zu entwickeln.
Gesetzliche Grundlagen und Inhalte der Anklageschrift
Der Inhalt der Anklageschrift ist in der StPO (§§ 199 ff.) geregelt. Ergänzende Vorschriften finden sich in den RiStBV (§§ 110–114).
Wichtige Bestandteile einer Anklageschrift:
- Angaben zum Angeschuldigten: Name, Anschrift, Geburtsdatum
- Tatbeschreibung: Zeitpunkt, Ort, Art und Weise der Tatbegehung
- Anklagesatz: Konkreter Tatvorwurf
- Strafvorschriften: Anwendbare Paragraphen aus StGB und Nebengesetzen
- Beweisstücke: Zeugen, Urkunden, Gutachten, ggf. Sachverständigengutachten
- Zusammenfassung des Ermittlungsstands: Begründung für den hinreichenden Tatverdacht
Die Anklageschrift dient nicht nur der Information des Gerichts, sondern auch dem Angeschuldigten, damit dieser die Strafverfolgung nachvollziehen kann und seine Verteidigungsrechte kennt.
Versand und Zuständigkeit
Die Staatsanwaltschaft versendet die Anklageschrift zunächst an das zuständige Gericht, das sie anschließend an den Angeschuldigten weiterleitet.
Bereits zu diesem Zeitpunkt kann ein Strafverteidiger prüfen, ob die Anklageschrift vollständig und ordnungsgemäß ist, Fristen überwachen und die nächsten Schritte planen. Dies ist besonders wichtig, da jede Fehlerhaftigkeit der Anklageschrift unter Umständen die Verteidigung erleichtern kann.
Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht
Die Zuständigkeit richtet sich nach der Schwere der Tat und dem zu erwartenden Strafmaß:
- Amtsgericht: Vergehen, Freiheitsstrafe ca. 4 Jahre
- Schöffengericht: Mittlere Freiheitsstrafen, Vergehen mit Höchststrafe 1–2 Jahre
- Landgericht: Verbrechen, Freiheitsstrafe > 4 Jahre
- Oberlandesgericht: Erstinstanzlich bei Staatsschutzdelikten
Die Zuständigkeit beeinflusst auch die Verfahrensdauer, die Anzahl der Zeugen und die Art der Hauptverhandlung. Ein erfahrener Strafverteidiger kann diese Faktoren frühzeitig in die Verteidigungsplanung einbeziehen.

Sie haben einen Anhörungsbogen von der Polizei erhalten? Mehr zu diesem Thema finden Sie in diesem Beitrag.
Verteidigungsoptionen gegen eine Anklage
Ein erfahrener Strafverteidiger kann:
- Akteneinsicht beantragen und prüfen, welche Beweise gegen Sie vorliegen
- Beweisanträge stellen, um entlastende Elemente in das Verfahren einzubringen
- Formale Einwände prüfen
- Auf Verfahrenseinstellung hinwirken, z.B. wegen Geringfügigkeit
- Eine Strategie für das Hauptverfahren entwickeln
Hinweis: Der Angeschuldigte hat das Recht zu schweigen, bis der Verteidiger die Akten eingesehen hat. Unüberlegte Aussagen können die Verteidigung erheblich erschweren.
Fristen beachten
Die Anklageschrift enthält in der Regel eine Frist von 1–2 Wochen, um auf die Vorwürfe Stellung zu nehmen.
Wichtig: Diese Frist sollte nicht eigenständig vom Angeschuldigten genutzt werden, sondern in Absprache mit dem Verteidiger, der die Akteneinsicht nutzt und die Verteidigungsstrategie vorbereitet.
Verfahrenseinstellung trotz Anklage
Auch nachdem die Anklageerhebung erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass das Strafverfahren eingestellt wird. Dies kann in unterschiedlichen Situationen erfolgen und hängt sowohl von den Umständen der Tat als auch vom Verhalten des Beschuldigten ab. Eine frühzeitige Einbindung eines erfahrenen Strafverteidigers kann entscheidend sein, um diese Option zu prüfen und zu nutzen.
Mögliche Gründe für die Verfahrenseinstellung:
- Geringfügigkeit oder Opportunitätsgründe
Liegt das Vergehen im unteren Schweregrad oder bestehen besondere Gründe, die eine Strafverfolgung unverhältnismäßig erscheinen lassen, kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach § 153 StPO einstellen. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn der Angeschuldigte erstmalige Verfehlungen begangen hat und keine weiteren strafrechtlich relevanten Risiken bestehen. - Reue und Entschuldigung gegenüber Geschädigten
Zeigt der Beschuldigte Reue, nimmt aktiv Kontakt zu den Geschädigten auf und entschuldigt sich aufrichtig, kann dies die Staatsanwaltschaft oder das Gericht dazu bewegen, das Verfahren einzustellen. In diesem Fall werden die Bemühungen des Verteidigers entscheidend, um die Geständnisse, Entschuldigungen und alle Beweismittel korrekt in den Prozess einzubringen. - Leistung einer Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation
Alternativ kann die Einstellung des Verfahrens erfolgen, wenn der Angeschuldigte einen Geldbetrag an eine gemeinnützige Einrichtung zahlt. Diese Maßnahme nach §§ 153 ff. StPO dient als Ausgleich und kann eine offizielle Hauptverhandlung verhindern. Auch hier ist die strategische Beratung durch einen Fachanwalt für Strafrecht entscheidend, damit die Bedingungen der Geldauflage korrekt erfüllt werden.
Vorteile einer Verfahrenseinstellung
Die Einstellung des Verfahrens bietet für den Beschuldigten mehrere Vorteile:
- Vermeidung einer langwierigen Hauptverhandlung vor Gericht
- Reduzierung oder Vermeidung einer möglichen Strafe
- Schutz des persönlichen und beruflichen Umfelds vor öffentlichen Belastungen
- Möglichkeit, die Angelegenheit möglichst geräuschlos und rechtlich sauber abzuschließen
Wichtig ist, dass jede Entscheidung sorgfältig abgewogen wird. Der Verteidiger prüft die Ermittlungen, die vorhandenen Beweismittel und die Schwere des Vergehens um die Erfolgsaussichten einer Verfahrenseinstellung realistisch einzuschätzen. Auch nach einer formellen Anklageerhebung kann die geschickte Einbindung dieser Möglichkeiten den weiteren Verlauf des Strafverfahrens maßgeblich beeinflussen.
Anklageschrift erhalten?
Lassen Sie sich jetzt von einem erfahrenen Fachanwalt für Strafrecht beraten – schnell, kompetent und vertraulich.

Hauptverhandlung: Ablauf und Dauer
Die Hauptverhandlung findet nach § 243 StPO statt. Sie beginnt, wenn keine Einwände gegen die Anklage vorgebracht werden oder diese zurückgewiesen wurden.
Die Dauer hängt vom Einzelfall ab. Das Gericht muss den Beschleunigungsgrundsatz beachten. In der Regel kann die Hauptverhandlung mehrere Monate dauern, abhängig von der Zahl der Zeugen, der Beweislage und der Komplexität des Falls.
Tipps für den Umgang mit Anklageschriften
- Frühzeitig einen Strafverteidiger einschalten
- Alle Fristen dokumentieren und einhalten
- Keine eigenständigen Stellungnahmen ohne juristische Beratung
- Beweismittel prüfen und ggf. entlastende Hinweise sammeln
- Auf professionelle Kommunikation mit Gericht und Staatsanwaltschaft achten
Diese Maßnahmen erhöhen die Chancen, dass das Verfahren für den Angeschuldigten günstig verläuft.

Weitere Themen aus dem Strafrecht Aktuell finden Sie hier.
Fazit
Die formelle Mitteilung über die Erhebung einer Klage ist ein zentraler Schritt im Strafverfahren, bedeutet jedoch nicht automatisch Schuld. Eine frühzeitige Beratung durch einen Strafverteidiger ist entscheidend, um:
- Rechte zu wahren
- Akteneinsicht zu erhalten
- Verteidigungsstrategie zu entwickeln
- Chancen auf ein günstiges Verfahren zu erhöhen
Auch bei einem Strafbefehl oder polizeilichen Vorladungen ist rechtzeitiges Handeln essenziell.
FAQ – Häufige Fragen zum Thema
Bildquellennachweis: sabthai I Canva.com
Jetzt beraten lassen
Das könnte Sie auch interessieren
Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten im Strafverfahren…
WeiterlesenWenn Sie einen Anhörungsbogen oder Äußerungsbogen…
Weiterlesen