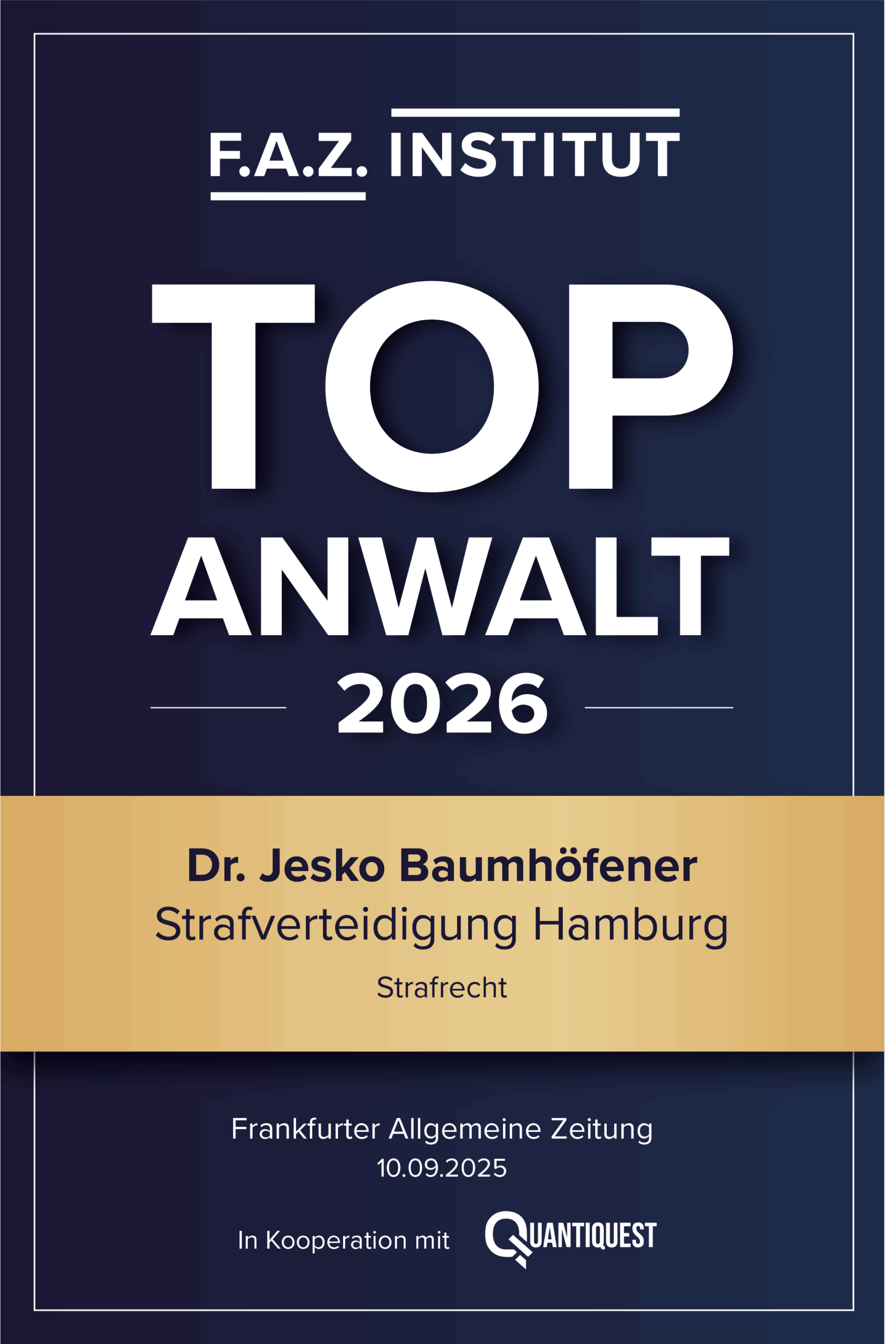Schon eine alltägliche Handlung kann dazu führen, dass unbescholtene Menschen oder kleine Unternehmen plötzlich dem Vorwurf der Geldwäsche ausgesetzt sind. Und das völlig ohne kriminelle Absicht. Ein typisches Beispiel ist der Verkauf über ein Online-Portal, bei dem der Kaufpreis über ein fremdes Konto fließt. Da der Straftatbestand der Geldwäsche sehr weit gefasst ist, kann bereits das Übersehen offensichtlicher Warnsignale den Verdacht einer leichtfertigen Geldwäsche begründen. Wer dann vorschnell reagiert oder unbedacht Auskünfte gegenüber der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erteilt, riskiert unnötige Nachteile im Ermittlungsverfahren.

In diesem Beitrag informiert der Hamburger Rechtsanwalt und Strafverteidiger Dr. Jesko Baumhöfener, Fachanwalt für Strafrecht, über Situationen, die schnell zu einem solchen Verdacht führen können. Er erläutert, was Geldwäsche nach § 261 StGB rechtlich bedeutet und worin der Unterschied zwischen fahrlässiger und leichtfertiger Geldwäsche liegt. Sie erfahren außerdem, welche Strafen drohen, wie Sie sich bei Post von Polizei oder Staatsanwaltschaft richtig verhalten und mit welchen praktischen Maßnahmen Sie das Risiko eines Ermittlungsverfahrens von vornherein reduzieren können.
Inhaltsverzeichnis:
- Wie schnell kann man wegen Geldwäsche ins Visier der Polizei geraten?
- Unwissenheit schützt nicht vor einem Geldwäsche-Vorwurf
- Was bedeutet Geldwäsche nach § 261 StGB?
- Was ist der Unterschied zwischen fahrlässiger und leichtfertiger Geldwäsche?
- Warum ist leichtfertige Geldwäsche so gefährlich?
- Wie kann man den Verdacht auf leichtfertige Geldwäsche vermeiden?
- Fazit: Was Sie über leichtfertige Geldwäsche wissen sollten
- Häufige Fragen (FAQ)
Wie schnell kann man wegen Geldwäsche ins Visier der Polizei geraten?
Stellen Sie sich vor, Sie verkaufen über ein Online-Portal ein gebrauchtes E-Bike. Kurz nach der Veröffentlichung Ihrer Anzeige meldet sich ein Käufer, der den Betrag sofort überweisen will. Allerdings möchte er den Betrag nicht von seinem eigenen Konto überweisen, sondern „über einen Freund“. Sie denken sich nichts Böses dabei und bestätigen den Zahlungseingang. Wenige Wochen später erhalten Sie Post von der Polizei, die Sie des Geldwäscheverdachts bezichtigt. Das Geld stammt offenbar aus einem Betrug und nun wird gegen Sie ermittelt.
Solche Fälle sind keine Seltenheit. Immer häufiger geraten ganz normale Menschen oder kleine Unternehmer unter den Verdacht, kriminelles Geld weitergeleitet oder angenommen zu haben. Und das ohne jede böse Absicht. Der Grund ist simpel: Der Tatbestand der Geldwäsche ist sehr weit gefasst. Schon wer unbedacht handelt oder Warnsignale übersieht, kann in den Verdacht der sogenannten leichtfertigen (umgangssprachlich: „fahrlässigen“) Geldwäsche geraten.
Typische Situationen sind das Weiterleiten von Geld für Bekannte, das Entgegennehmen hoher Barzahlungen oder die Nutzung des eigenen Kontos für Dritte. In vielen Fällen erkennen Betroffene erst im Nachhinein, dass sie sich mit einer eigentlich gut gemeinten Handlung rechtlichen Risiken ausgesetzt haben.

Sie haben einen Vorwurf wegen Hehlerei? Mehr zu diesem Thema lesen Sie in diesem Beitrag
Unwissenheit schützt nicht vor einem Geldwäsche-Vorwurf
Der Satz „Ich wusste doch von nichts“ schützt im Strafrecht nicht automatisch. Nach § 261 StGB kann sich auch derjenige strafbar machen, der leichtfertig handelt. Das kann jemand sein, der bei genauerem Hinsehen hätte merken können, dass das Geld aus einer Straftat stammen könnte. Die Schwelle zur Strafbarkeit ist damit niedriger als viele denken.
Wer Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erhält, sollte die Situation daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Ermittlungsverfahren bedeutet nicht, dass Sie schuldig sind, sondern dass Ihr Verhalten überprüft wird.
In dieser Situation ist Folgendes von größter Bedeutung: Schweigen Sie, bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie sofort anwaltliche Hilfe in Anspruch. Ein erfahrener Strafverteidiger kann frühzeitig eingreifen, um zu verhindern, dass aus einem Missverständnis ein Strafverfahren wird und aus einer unbedachten Äußerung ein Anhaltspunkt für eine Strafbarkeit entsteht.
Was bedeutet Geldwäsche nach § 261 StGB?
Wer den Begriff Geldwäsche hört, denkt oft an organisierte Kriminalität, Drogenhandel oder internationale Finanztransfers und schreckt erstmal zusammen. Tatsächlich kann sich der Straftatbestand aber auch in alltäglichen Situationen erfüllen. Gemäß § 261 Strafgesetzbuch (StGB) liegt Geldwäsche immer dann vor, wenn jemand Vermögenswerte nutzt, entgegennimmt, verwahrt oder weiterleitet, die aus einer Straftat stammen, und dadurch die Herkunft dieser Gelder verschleiert. Das Ziel dabei ist, illegal erworbenes Geld so in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, dass es „sauber“ erscheint.
So funktioniert Geldwäsche
Der Gesetzgeber verfolgt mit § 261 StGB das Ziel, kriminelle Gewinne zu blockieren und deren Nutzung zu verhindern. Eine Strafbarkeit liegt demnach vor, wenn man Geld oder Gegenstände verwendet, die aus einer rechtswidrigen Tat stammen, und wenn man weiß oder leichtfertig nicht erkennt, woher das Vermögen kommt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man selbst an der ursprünglichen Straftat beteiligt war. Entscheidend ist allein, dass man mit bemakelten Geldern oder anderen Wertgegenständen in Berührung kommt.
Der Begriff Geldwäsche beschreibt also nicht nur das Verbergen der Herkunft, sondern auch das Verwahren, Weiterleiten oder Verwenden solcher Gelder. Schon die Annahme eines Betrags auf dem eigenen Konto kann eine Geldwäschehandlung darstellen, wenn der Absender aus einer kriminellen Tätigkeit stammt und der Empfänger diese Umstände hätte erkennen können.
All-Crimes-Ansatz: keine spezifische Vortat mehr notwendig
Früher konnte Geldwäsche nur aus bestimmten Vortaten entstehen, etwa aus Drogenhandel, Betrug oder Korruption. Seit einer Änderung von § 261 StGB gilt in Deutschland der sogenannte All-Crimes-Ansatz. Das bedeutet, dass jede rechtswidrige Tat, auch ein vermeintlich geringfügiges Delikt, als Vortat einer Geldwäsche gelten kann. Damit ist der Anwendungsbereich des § 261 StGB sehr weit gefasst.
Für Privatpersonen und kleinere Unternehmen hat das weitreichende Folgen. Schon wenn sie mit Geldern in Berührung kommen, die mittelbar aus einer Straftat stammen, können sie in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Es genügt, wenn sie den Verdacht nicht ausreichend prüfen oder offensichtliche Warnsignale übersehen.
Strafbarkeit der Geldwäsche
Nicht jede Zahlung oder jeder Geldtransfer ist automatisch Geldwäsche. Eine Handlung ist erst dann strafbar, wenn der Betroffene weiß oder zumindest leichtfertig nicht erkennt, dass das Geld aus einer Straftat stammt. Leichtfertigkeit bedeutet, dass jemand grob unachtsam handelt und eindeutige Hinweise ignoriert, die auf eine kriminelle Herkunft hindeuten.
Ein klassisches Beispiel ist die Annahme hoher Barzahlungen ohne nachvollziehbare Begründung oder das Weiterleiten von Geldern, deren Ursprung unklar bleibt. In solchen Fällen gehen die Ermittlungsbehörden schnell von einer geldwäsche-relevanten Handlung aus.
Geldwäsche kann jeden treffen
Der Straftatbestand der Geldwäsche ist bewusst sehr weit gefasst, um kriminelle Finanzströme möglichst effektiv zu bekämpfen. Dadurch geraten jedoch auch Menschen ins Visier, die keine kriminelle Absicht hatten. Schon alltägliche Vorgänge wie der Verkauf eines Gebrauchtwagens, das Annehmen einer größeren Barzahlung oder die Nutzung des eigenen Kontos für Dritte können zu Ermittlungen führen, wenn der Verdacht einer illegalen Herkunft im Raum steht.
Wer Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erhält, sollte sich der Tragweite dessen bewusst sein. Eine falsche oder vorschnelle Aussage kann die Situation verschärfen.
Jetzt rechtzeitig handeln – bevor aus einem Verdacht ein Verfahren wird
Holen Sie sich sofort rechtlichen Beistand, wenn Ihnen leichtfertige oder fahrlässige Geldwäsche vorgeworfen wird – kompetent, vertraulich und schnell.

Was ist der Unterschied zwischen fahrlässiger und leichtfertiger Geldwäsche?
Viele Menschen, die erstmals Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche erhalten, fragen sich, wie sie sich strafbar gemacht haben, wenn sie gar nichts von einer Geldwäsche-Handlung oder einer Vortat wussten. In solchen Zusammenhängen taucht häufig der Begriff „fahrlässige Geldwäsche“ auf. Juristisch korrekt ist das jedoch nicht. Das deutsche Strafgesetzbuch kennt keine fahrlässige Geldwäsche, sondern nur die leichtfertige Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 6 StGB.
Leichtfertige Geldwäsche
Leichtfertige Geldwäsche liegt vor, wenn jemand Geld oder Vermögenswerte verwendet, entgegennimmt oder weiterleitet, die aus einer Straftat stammen, und dabei offensichtliche Warnsignale ignoriert. Es geht also nicht darum, dass der Betroffene etwas absichtlich getan hat, sondern darum, dass er grob unachtsam war und die kriminelle Herkunft bei genauerem Hinsehen hätte erkennen müssen.
Das Gesetz stellt damit auf eine besonders schwerwiegende Form der Unachtsamkeit ab. Juristen beschreiben Leichtfertigkeit als eine Steigerung der Fahrlässigkeit, kombiniert mit Gleichgültigkeit oder Nachlässigkeit gegenüber offensichtlichen Risiken. Wer also Warnzeichen übersieht oder übersehen will, die jedem durchschnittlichen Menschen hätten auffallen müssen, kann sich strafbar machen, auch wenn er nicht wusste, dass das Geld aus einer Straftat stammt.
Unterschied einfache Fahrlässigkeit von Leichtfertigkeit
Einfach fahrlässig handelt jemand, der einen Fehler macht, ohne die nötige Sorgfalt walten zu lassen, etwa aus Unachtsamkeit oder Unwissen. Das kann im Alltag jedem passieren und ist nicht strafbar, solange keine grobe Nachlässigkeit vorliegt.
Leichtfertigkeit hingegen setzt voraus, dass die Anzeichen für eine mögliche Straftat so deutlich waren, dass man sie hätte erkennen müssen. Es reicht also nicht aus, dass man schlicht nicht nachgefragt hat. Entscheidend ist, dass ein verständiger Mensch in derselben Situation sofort stutzig geworden wäre.
Beispielsweise handelt jemand leichtfertig, wenn er für eine fremde Person größere Geldbeträge über sein Konto laufen lässt, ohne sich klar erklären zu lassen, woher das Geld stammt. Auch wer hohe Barzahlungen entgegennimmt, ohne nachzufragen, oder auf vermeintliche Jobangebote eingeht, bei denen man Geld weiterleiten soll, riskiert den Vorwurf der leichtfertigen Geldwäsche.
Verwechslung von Leichtfertigkeit und Fahrlässigkeit
In der Praxis wird der Begriff „fahrlässige Geldwäsche” häufig verwendet, obwohl er juristisch nicht korrekt ist. Ermittlungsbehörden und Medien nutzen ihn, um auszudrücken, dass jemand ohne Vorsatz, also nicht absichtlich, gehandelt hat. Damit ist jedoch fast immer die leichtfertige Geldwäsche gemeint. Der Begriff „Fahrlässigkeit“ ist der Öffentlichkeit eher geläufig als der Begriff „Leichtfertigkeit“, der für juristische Laien schwer fassbar ist.
Für Betroffene ist dieser Unterschied wichtig, da nur die Leichtfertigkeit bzw. die leichtfertige Geldwäsche strafbar ist. Wer lediglich leicht fahrlässig, also ohne grobe Unachtsamkeit, gehandelt hat, bleibt straflos. Somit erfüllt nicht jede Sorglosigkeit den Tatbestand des § 261 StGB. Sobald aber deutliche Warnsignale ignoriert wurden, kann die Grenze zur Strafbarkeit überschritten sein.
Folgen der leichtfertigen Geldwäsche
Auch wenn keine Absicht vorlag, ist leichtfertige Geldwäsche kein Kavaliersdelikt. Sie wird zwar deutlich milder bestraft als die vorsätzliche Geldwäsche (Strafrahmen: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe), ist aber kein Kavaliersdelikt. Dennoch kann die leichtfertige Geldwäsche nach § 261 Abs. 6 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Hinzu kommen häufig Kontosperrungen, Sicherstellungen von Vermögenswerten und langwierige Ermittlungen.
Darum ist es entscheidend, sich im Ernstfall professionell vertreten zu lassen. Ein erfahrener Strafverteidiger wie Dr. Jesko Baumhöfener kann prüfen, ob tatsächlich eine leichtfertige Handlung vorlag oder die Behörden die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht zu streng auslegen.
Leichtfertigkeit ist mehr als nur Unachtsamkeit
Leichtfertige Geldwäsche bedeutet, dass jemand grob unvorsichtig handelt und offensichtliche Risiken ignoriert. Eine fahrlässige Geldwäsche im engeren Sinne gibt es im deutschen Strafrecht nicht. Wer jedoch Warnsignale übersieht oder verdächtige Geldbewegungen nicht hinterfragt, kann sich strafbar machen, auch ohne es zu wollen.
Wer in den Verdacht einer Straftat, insbesondere der Geldwäsche, gerät, sollte deshalb keine Erklärungen abgeben oder unbedachte Aussagen tätigen, sondern sofort rechtlichen Beistand suchen. So lässt sich oft klären, ob tatsächlich eine leichtfertige Handlung vorliegt oder der Verdacht unbegründet ist.
Warum ist leichtfertige Geldwäsche so gefährlich?
Der Begriff „leichtfertige Geldwäsche” klingt für viele Betroffene zunächst harmlos, da keine Absicht hinter dem Vorwurf stecken mag. In der Praxis kann sie jedoch schwerwiegende Folgen haben. Der Straftatbestand wird von den Ermittlungsbehörden häufig genutzt, wenn kein Vorsatz nachweisbar ist. Schon kleine Unachtsamkeiten oder unklare Geldbewegungen können ausreichen, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Warum Ermittlungsverfahren oft schneller beginnen, als man denkt
Bei Geldwäsche müssen die Behörden nicht beweisen, dass jemand bewusst kriminelles Geld weitergeleitet hat. Es genügt bereits der Verdacht, dass die illegale Herkunft leichtfertig übersehen wurde. Ein ungewöhnlicher Zahlungseingang, eine anonyme Überweisung oder ein hoher Barbetrag können beispielsweise den Anfangsverdacht auslösen, wenn sie übersehen und nicht hinterfragt wurden. Banken, Zahlungsdienstleister und weitere nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichtete sind gesetzlich dazu verpflichtet, auffällige Transaktionen zu melden. Dadurch kann es auch bei unbescholtenen Bürgern oder Unternehmern sehr schnell zu Ermittlungen kommen.
Diese Folgen drohen im Ermittlungsverfahren
Einmal eingeleitete Ermittlungen wegen leichtfertiger Geldwäsche sind für Betroffene enorm belastend. Oft sperren Banken vorsorglich Konten oder melden Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU). In manchen Fällen werden Vermögenswerte eingefroren, um eine mögliche Rückverfolgung der Gelder zu sichern. Selbst wenn sich der Verdacht später als unbegründet herausstellt, können diese Maßnahmen zu erheblichen finanziellen und beruflichen Einschränkungen führen.
Für Selbstständige und Unternehmer kann eine Kontosperrung sogar existenzgefährdend sein. Laufende Geschäfte geraten ins Stocken, Zahlungen bleiben aus und das Vertrauen von Geschäftspartnern leidet. Hinzu kommt die psychische Belastung durch das Ermittlungsverfahren selbst, das sich oft über viele Monate hinzieht.
Deshalb ist frühe anwaltliche Hilfe entscheidend
Gerade weil Geldwäsche oft aus Leichtfertigkeit geschieht, besteht in vielen Fällen die Möglichkeit, ein Verfahren frühzeitig zu beenden. Ein erfahrener Strafverteidiger kann prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen überhaupt erfüllt sind und ob die Ermittlungen auf einer tragfähigen Grundlage beruhen. Ziel ist es, den Vorwurf so früh wie möglich zu entkräften und Maßnahmen wie Kontosperrungen oder Beschlagnahmen aufheben zu lassen.
Der Hamburger Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. Jesko Baumhöfener vertritt regelmäßig Mandanten, die sich plötzlich mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert sehen. Durch seine langjährige Erfahrung im Wirtschaftsstrafrecht weiß er, worauf es in solchen Verfahren ankommt. Er kann Einblick in die Ermittlungsakte nehmen, diese analysieren und die Beweislage bewerten. Auf dieser Grundlage entwickelt er eine individuelle Verteidigungsstrategie, um die Belastung für Betroffene so gering wie möglich zu halten.
Wer Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erhält, sollte daher keine Zeit verlieren und sich sofort rechtlich beraten lassen. Eine frühzeitige und kompetente Verteidigung kann entscheidend sein, um das Verfahren schnell zu beenden und die eigenen finanziellen Interessen zu schützen.
Wie kann man den Verdacht auf leichtfertige Geldwäsche vermeiden?
Wer einmal in den Verdacht der Geldwäsche geraten ist, weiß, wie schnell eine einfache Alltagshandlung ernste Folgen haben kann. Dabei lässt sich das Risiko, versehentlich in ein Ermittlungsverfahren wegen leichtfertiger Geldwäsche zu geraten, oft mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen deutlich verringern. Entscheidend ist, aufmerksam zu bleiben und verdächtige Situationen frühzeitig zu erkennen.
In folgenden Situationen sollten Sie wachsam sein:
- Übernehmen Sie keine Geldtransfers für Dritte: Ein häufiger Ausgangspunkt für Ermittlungen ist das Weiterleiten von Geldbeträgen für andere Personen. Selbst wenn die Bitte harmlos klingt oder von Bekannten kommt, sollten Sie solche Transaktionen grundsätzlich ablehnen. Wer Geldbeträge empfängt und weiterleitet, ohne die Herkunft zu kennen, kann schnell in den Verdacht geraten, kriminelles Geld „durchzuschleusen“. Das gilt auch für Zahlungen im Zusammenhang mit Nebenjobs oder Online-Geschäften, bei denen das eigene Konto genutzt werden soll.
- Herkunft von Geldern immer hinterfragen: Bei ungewöhnlich hohen Barzahlungen, internationalen Überweisungen oder Geldflüssen über unbekannte Dritte ist Vorsicht geboten. Fragen Sie immer nach, woher das Geld stammt und wofür es bestimmt ist. Seriöse Geschäftspartner oder Käufer haben kein Problem damit, diese Angaben offen zu machen. Wer hier einfach vertraut, ohne die Umstände zu prüfen, kann den Vorwurf der leichtfertigen Geldwäsche auf sich ziehen, selbst wenn keine böse Absicht bestand.
- Verdächtige Zahlungen dokumentieren: Wenn eine Zahlung ungewöhnlich erscheint, ist es sinnvoll, alle relevanten Informationen festzuhalten. Dazu gehören Namen, Kontodaten, Nachrichtenverläufe oder Rechnungen. Eine saubere Dokumentation hilft im Zweifel dabei, nachzuweisen, dass Sie mit gutem Grund von einer legalen Transaktion ausgegangen sind. Alle Geschäftsvorgänge sollten von Unternehmern nachvollziehbar und transparent dokumentiert werden, sofern dies nicht schon durch andere gesetzliche Vorgaben vorgeschrieben ist.
- Für Unternehmer gelten besondere Pflichten: Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen viele Unternehmen bestimmte Sorgfalts- und Meldepflichten erfüllen. Dazu zählen unter anderem Identitätsprüfungen von Geschäftspartnern und die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Wer diese Pflichten missachtet, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch strafrechtliche Ermittlungen. Unternehmer sollten daher interne Kontrollsysteme einrichten, regelmäßige Schulungen durchführen und klare Abläufe für verdächtige Vorgänge festlegen.
- Im Zweifel anwaltlichen Rat einholen: Gerade bei größeren Transaktionen oder Unsicherheiten über die Herkunft von Geldern lohnt sich eine frühzeitige rechtliche Beratung. Dr. Jesko Baumhöfener, Hamburger Strafverteidiger und Fachanwalt für Strafrecht, berät regelmäßig Mandanten, die ein mögliches Geldwäscherisiko erkennen oder vermeiden möchten. Aufgrund seiner Erfahrung im Wirtschaftsstrafrecht weiß er, welche Vorkehrungen sinnvoll sind und wie man sich im Ernstfall richtig verhält. Eine rechtliche Einschätzung kann dabei helfen, Risiken zu erkennen, bevor diese zu einem Ermittlungsverfahren führen.
Wachsamkeit ist der beste Schutz
Leichtfertige Geldwäsche entsteht oft aus Gutgläubigkeit. Wer aufmerksam handelt, Zahlungen kritisch hinterfragt und verdächtige Vorgänge dokumentiert, kann sich effektiv schützen. Im Zweifel gilt: Lieber einmal mehr nachfragen oder rechtlichen Rat einholen, als später unter Verdacht zu geraten.
Wenn Sie bereits Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erhalten haben oder unsicher sind, ob eine Transaktion problematisch sein könnte, sollten Sie keine Zeit verlieren. Vereinbaren Sie jetzt ein vertrauliches Beratungsgespräch mit Dr. Jesko Baumhöfener und erfahren Sie, welche Schritte Sie sofort unternehmen sollten, um Ihre Rechte zu schützen.
Fazit: Was Sie über leichtfertige Geldwäsche wissen sollten
- Geldwäsche kann jeden treffen: Nicht nur Kriminelle oder das organisierte Verbrechen geraten ins Visier der Ermittlungsbehörden im Bereich der Geldwäsche. Auch alltägliche Handlungen wie das Weiterleiten von Geld, das Annehmen hoher Barzahlungen oder die Nutzung des eigenen Kontos für Dritte können den Verdacht der Geldwäsche begründen. Der Straftatbestand ist weit gefasst und betrifft längst auch Privatpersonen und kleinere Unternehmen.
- Unwissenheit schützt nicht: Der Satz „Ich wusste doch von nichts“ bietet keinen Schutz. Nach § 261 Abs. 6 StGB kann sich auch derjenige strafbar machen, der leichtfertig handelt. Wer Warnsignale übersieht oder nicht nachfragt, obwohl der Geldfluss ungewöhnlich erscheint, kann schnell in den Verdacht geraten, illegale Gelder weitergeleitet zu haben.
- Leichtfertige Geldwäsche ist kein Kavaliersdelikt: Leichtfertige Geldwäsche ist juristisch keine bloße Unachtsamkeit, sondern eine schwerwiegende Form der Sorglosigkeit. Sie kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Hinzu kommen Kontosperrungen, Ermittlungsverfahren und erhebliche wirtschaftliche Folgen.
- Prävention schützt vor Verdacht: Wachsamkeit und gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz. Übernehmen Sie keine Geldtransfers für Dritte, hinterfragen Sie die Herkunft größerer Beträge und dokumentieren Sie verdächtige Zahlungen sorgfältig. Unternehmer sollten zudem die Pflichten des Geldwäschegesetzes (GwG) genau kennen und interne Kontrollmechanismen einrichten.
- Frühzeitige anwaltliche Hilfe ist entscheidend: Wer Post von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft erhält, sollte keine Erklärungen abgeben, bevor er einen erfahrenen Strafverteidiger eingeschaltet hat. Ein Strafverteidiger kann Akteneinsicht beantragen, die Beweislage prüfen und verhindern, dass aus einem Verdacht ein Strafverfahren wird.
Wenn Sie selbst betroffen sind oder den Verdacht haben, ungewollt in eine Geldwäschehandlung verwickelt zu sein, sollten Sie umgehend professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Der Hamburger Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. Jesko Baumhöfener berät und verteidigt Mandanten in allen Phasen eines Geldwäscheverfahrens: vom ersten Verdacht bis zur Hauptverhandlung.
Vereinbaren Sie jetzt ein vertrauliches Beratungsgespräch und erfahren Sie, wie Sie sich effektiv gegen den Vorwurf der leichtfertigen Geldwäsche verteidigen können.
Häufige Fragen (FAQ)
Bildquellnachweis: Alexas_Fotos | Canva.com
Jetzt beraten lassen
Das könnte Sie auch interessieren
Sie haben eine Vorladung erhalten wegen Bestechung oder Bestechlichkeit?…
WeiterlesenSie haben eine Vorladung wegen § 299 StGB erhalten?…
WeiterlesenVerteidigung gegen den Vorwurf eines Abrechnungsbetrugs oder eines ärztlichen…
Weiterlesen